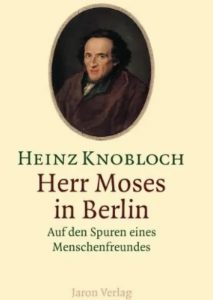Dieser Beitrag ist ein Crosspost der zeitgleich auf dem Blog der Autorin, Halina Wawzyniak, erscheint. Halina Wawzyniak problematisiert in ihrer Kolumne die Politisierung juristischer Begriffe, die droht die Gewaltenteilung in Frage zu stellen. Sie debattiert dabei beispielhaft den Umgang mit Begriffen wie Enteignung vs. Vergesellschaftung, Genozid und Vökermord, sowie die Konventionen, denen Staatsanerkennungen zugrunde liegen.
Die Politisierung juristischer Begriffe hat gerade Hochkonjunktur. Unter Politisierung juristischer Begriffe verstehe ich, wenn zur Begründung einer politischen Auffassung auf einen Begriff Bezug genommen wird, der eine juristische Bedeutung und einen juristischen Hintergrund hat. Die Politisierung juristischer Begriffe ist aus meiner Sicht ein großes Problem – denn am Ende stellt sie die Gewaltenteilung in Frage. Die Machtbeschränkungs- und die Ermöglichungsfunktion von Recht geht verloren, ob etwas geschieht oder unterlassen wird ist dann allein von politischen Opportunitätserwägungen abhängig, nicht mehr von Rechtsetzung. Diskussion um Veränderungen von Recht und Rechtslauslegung werden obsolet.
Enteignung vs. Vergesellschaftung
Die Vergesellschaftungsinitiative Berlin hat den Namen „DW enteignen“. Es geht aber nicht um Enteignung, es geht um Vergesellschaftung. Der Name hat vermutlich historische Ursachen und natürlich wäre es absurd, den Namen zu ändern. In der politischen Kommunikation sollte der Unterschied zwischen Vergesellschaftung und Enteignung aber deutlich gemacht werden. Vergesellschaftung mag ein wenig sperrig klingen, weshalb auch Sozialisierung gesagt werden könnte. Die ständige Verwendung des Begriffs „Enteignung“ wenn es um die Vergesellschaftung von Grund und Boden großer Immobilienkonzerne geht klingt total radikal. Enteignung ist nur nicht radikal, Enteignung verharrt anders als Vergesellschaftung im kapitalistischen System. Die Idee einer anderen Wirtschaftsweise ist im Begriff Vergesellschaftung angelegt.
Wenn es wirklich um eine andere Produktionsweise geht, dann geht das vor allem mit Vergesellschaftung, wissend um die Einschränkung der Anwendungsmöglichkeiten. Vergesellschaftung ist etwas anderes als Enteignung. Der Art. 14 GG enthält eine Eigentumsgarantie (Gewährleistungsgarantie) und hält gleichzeitig fest, dass der Gebrauch des Eigentums dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll. Was konkret Eigentum ist, regelt der § 903 BGB. Das BVerfG hat im Hinblick auf die Gewährleistungsgarantie des Eigentums formuliert: »Die Gewährleistung des Rechtsinstituts wird nicht angetastet, wenn für die Allgemeinheit lebensnotwendige Güter zur Sicherung überragender Gemeinwohlbelange und zur Abwehr von Gefahren nicht der Privatrechtsordnung, sondern einer öffentlich-rechtlichen Ordnung unterstellt werden.« (BVerfGE 58, 300, Rdnr. 174). Anders formuliert: Mit staatlichen Ordnungsmitteln unterhalb von Enteignung und Vergesellschaftung kann geregelt werden, wie Eigentum zu verwenden ist, ohne das eine verfassungswidrige Verletzung der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG vorliegt. Wenn dies geschieht, handelt es sich um Inhalts- und Schrankenbestimmungen.
Daneben gibt es die Enteignungsmöglichkeit in Art. 14 GG – zum Wohle der Allgemeinheit. Nach der Definition des BVerfG bedeutet Enteignung: »Die Enteignung im verfassungsrechtlichen Sinn ist auf die vollständige oder teilweise Entziehung konkreter subjektiver Eigentumspositionen im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben gerichtet.« (BVerfGE 70, 191, Rdnr. 30). Was nach dem Entzug der Eigentumsposition passiert und wer neuer Eigentümer oder neue Eigentümerin werden kann, ist damit nicht geklärt. Voraussetzung ist lediglich die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Und zu der gehört traditionell der Bau von Autobahnen und Flughäfen. Dafür fanden nämlich viele Enteignungen statt. Wenn der zukünftige Eigentümer oder die zukünftige Eigentümerin Profit erwirtschaften will ist das aber auch völlig okay, soweit nur eine öffentliche Aufgabe erfüllt wird. Ja, die Vergesellschaftung ist auf drei Vergesellschaftungsgegenstände beschränkt – Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel. Aber im Gegensatz zur Enteignung ist vorgeschrieben, dass diese Vergesellschaftungsgegenstände in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden müssen. Und bei Gemeinwirtschaft geht es um die Deckung eines öffentlichen oder gesellschaftlichen Bedarfes ohne Gewinnabsicht zur Verfolgung von Gemeinwohlzielen (von Mangoldt/Klein/Starck 2010, Art. 15, Rdnr. 16; BeckOK, Art. 15, Rdnr. 11).
In der politischen Kommunikation Vergesellschaftung und Enteignung zu vermischen ist aus meiner Sicht ein Fehler: Es wird auf der einen Seite etwas Radikales suggeriert, was gar nicht radikal ist und auf der anderen Seite wird immer mal wieder eine Vergesellschaftung eingefordert, die nicht machbar ist. Das wiederum entlässt die interessierte Rechtswissenschaft aus der Verantwortung eine Auseinandersetzung um den breitestmöglichen Anwendungsbereich des Artikel 15 GG zu führen, bei der es vor allem um eine weite Auslegung des Begriffs „Produktionsmittel“ gehen muss.
Schließlich gilt es noch ein Missverständnis auszuräumen: Vergesellschaftung ist nicht per se Verstaatlichung. Gemeineigentum »bedeutet Eigentum einer kollektiven Gesamtheit und zeichnet sich dadurch aus, dass statt eines Individuums der Staat, die Gemeinden oder sonstige Selbstverwaltungseinrichtungen Träger des Eigentumsrechts sind« (BeckOK, Art.15, Rdnr. 12) Nicht nur aus historischen Gründen, sondern auch aus Gründen einer gesunden Skepsis gegen den Staat, ist immer wieder zu betonen, dass Vergesellschaftung nach Art. 15 GG es zwar zulässt, dass der Staat Träger des Eigentumsrechts wird, dies aber zum Glück nicht zwingend ist. Bei Vergesellschaftungen sollte der Fokus immer auf Selbstverwaltungseinrichtungen als Träger des Eigentumsrechts liegen, denen staatliche Akteure zur Seite gestellt werden können. Grundsätzlich gilt: »Gemeineigentum ist von der Verstaatlichung zu unterscheiden, da es nicht ausreicht, Eigentum in Händen des Staates zu begründen, sondern es muss auch die Form des Wirtschaftens geändert werden.« (BeckOK, Art.15, Rdnr. 12)
Genozid/Völkermord
Die Debatte um den Begriff Genozid ist emotionalisiert und ebenfalls ein Beispiel für die Politisierung. Die Debatte unterscheidet nicht mehr zwischen § 6 Völkerstrafgesetzbuch (Völkermord) und § 7 Völkerstrafgesetzbuch (Verbrechen gegen die Menschlichkeit). Es muss radikal klingen, weswegen es nicht ausreichen soll, zum Beispiel die aktuelle Politik der rechten Regierung Netanjahu als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bezeichnen. Wer nicht Genozid sagt, erkennt das Leid von Palästinenserinnen und Palästinensern nicht an – so meine Wahrnehmung des öffentlichen Diskurses.
Ohne sich in den Einzelheiten der beiden Straftatbestände zu verheddern, dürfte mittlerweile –nein, nicht von Anfang an- der § 7 VStGB erffüllt sein. Es gab aus meiner Sicht selbstverständlich das Recht des Staates Israel sich gegen den Akt des Vernichtungsantisemitismus der Hamas vom 07. Oktober 2023 zu verteidigen, der Pfad der Selbstverteidigung dürfte aber mittlerweile sehr deutlich verlassen sein. Die Behandlung der Geiseln durch die Terrororganisation Hamas wiederum dürfte ebenfalls den Straftatbestand des § 7 VStGB erfüllen.
Der Tatbestand des Völkermordes hat erst durch die Resolution 96 der Generalversammlung der Vereinten Nationen seine Verselbständigung vom Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit gefunden und mündete schließlich in der Völkermordkonvention von 1948. Was juristisch unter Völkermord zu verstehen ist, wurde in Artikel III verankert und findet sich in § 6 VStGB wieder. In der politischen Debatte geht aus meiner Sicht unter, dass die Erfüllung eines Straftatbestandes die Erfüllung eines objektiven Tatbestandes und eines subjektiven Tatbestandes erfordert. Es reicht für den rechtlichen Vorwurf einer Straftat (und erst Recht für eine Verurteilung) nicht aus, dass objektiv etwas geschehen ist (z.B. Tötung, körperlicher Schaden, zerstörungsgeeignete Lebensbedingungen z.B. durch mangelhafte Ernährung, Verhinderung von Geburten innerhalb einer Gruppe und systematische Kindesentziehung). Es entwertet im Übrigen den Straftatbestgand des Völkermordes, wenn insbesondere auf die Anzahl der getöteten Menschen verwiesen wird. Denn es kommt nicht auf die Anzahl an, sondern auf die Absicht, für den Völkermord ist zwingend ein subjektives Element erforderlich (dazu gleich).
Die Gruppe der Palästinenserinnen und Palästinenser dürfte deutlich größer sein, als die Menschen, die in Gaza leben. Der Völkermordstraftatbestand erlaubt, auf Teile einer Gruppe abzustellen. Hinsichtlich der Vertreibung, die unermessliches Leid über die Betroffenen bringt, hat der BGH im Jahr 2001 geurteilt (BGH, 3 StR 244/00): „Bedenken in Bezug auf die Erfüllung des objektiven Tatbestands des § 220a Abs. 1 Nr. 3 StGB (heute § 6 VStGB- H.W.) bestehen insofern, als die bloße Vertreibung der Muslime aus ihren Häusern und ihrem Heimatort für sich genommen noch keine unter § 220a Abs. 1 Nr. 3 StGB fallende Völkermordhandlung darstellt. Die Voraussetzung dieser Tatbestandsalternative – Auferlegung von Lebensbedingungen, die geeignet sind, die körperliche Zerstörung der Gruppe ganz oder teilweise herbeizuführen – werden vielmehr erst durch die Gesamtheit der gegen die muslimische Bevölkerung gerichteten Terror- und Vernichtungsmaßnahmen erreicht.“
In der politischen Debatte wird aber nicht zwischen politischem und juristischem Völkermordbegriff differenziert, sondern der politische Vorwurf als juristisch untersetzt dargestellt. Das erleichtert die Vermeidung der Befassung mit dem für den Völkermord erforderlichen subjektiven Element. Für eine Strafbarkeit ist Vorsatz erforderlich. Vorsatz ist Wissen und Wollen des Taterfolges. Beim entscheidenden Merkmal der „Absicht“ aber gibt es einen juristischen Streit. Der BGH und Teile der juristischen Wissenschaft verlangen ein zielgerichtetes Wollen, dem Täter muss es auf die Zerstörung der Gruppe ankommen (BGH, 3 StR 244/00), einfacher formuliert: Es muss gerade das Ziel sein, die Gruppe zu zerstören. Die Folge der Zerstörung auf Grund anders motivierter Handlungen reicht danach nicht aus. Einer anderen Auffassung nach soll die Völkermordabsicht auch dann bestehen, wenn wissentlich ein Beitrag zu einem Gesamtunrechtsgeschehen geleistet wird, das zwar nicht auf die Zerstörung einer (Teil-)Gruppe zielt, eine solche Zerstörung indessen nach Lage der Dinge offenkundig zur Folge hat. Die Internationale Rechtsprechung verlangt derzeit wohl ein „zielgerichtetes Wollen“ (vgl. Münchener Kommentar zum StGB, § 6 VStGB Rn. 80). Um es auch hier kurz zu formulieren: Die Handlung muss danach das Ziel haben, die Teilgruppe zu zerstören. Hier soll der entscheidende Unterschied zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7 VStGB liegen.
Diesen juristischen Streit und die derzeit herrschende Rechtsprechung nicht zur Kenntnis zu nehmen macht die Debatte so schwierig. Es wird eine Überzeugung postuliert, ohne auf rechtliche Rahmen einzugehen. Wenn -kliene anekdotische Anmerkung- in Debatten hinterfragt wird, warum es der Genozid-Vorwurf sein muss und nicht der Vorwurf des Verbrechens gegen die Menschlichkeit unterbleibt eine Antwort, zweimal ist es mir passiert das mein Gegenüber den Unterschied nicht kannte. Der politische Genozid-Vorwurf auf die derzeitige rechtliche Folie gelegt bedeutet, ist die Absicht/das Ziel rechten Regierung von Netanjahu die Gruppe der Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza zu zerstören.
Es gab durchaus Stimmen, die eine solche Behauptung unmittelbar nach dem 7. Oktober 2023 vertreten haben. Da haben sich dann im Ergebnis aus völlig unterschiedlichen Motiven Teile der PostkolanialenBewegung und diejenigen, deren Vorfahren die industrielle Vernichtung von Jüdinnen und Juden zu verantworten haben, getroffen. Die „Befreiung von deutscher Schuld“ war für letztere dann sehr willkommen, weil „der Jude“ begeht ja auch einen Völkermord. Die systematische Verfolgung und industrielle Ermordung von Jüdinnen und Juden durch die Vorfahren ist dann nicht mehr ganz so schrecklich.
Staatsanerkennung
Vorab: Eine Zweistaatenlösung im Nahen Osten ist aus meiner Sicht eine wünschenswerte Lösung. Ein konkreter Teilungsplan lag 1947 (Resolution 181 der UN-Generalversammlung vom 27. November 1947) vor. Von der UN-Generalversammlung angenommen, von den arabischen Staaten abgelehnt.
Für die Anerkennung von Staaten gibt es die Konvention von Montevideo aus dem Jahr 1933. Richtig ist, dass die Konvention nur die Vertragsstaaten bindet. Dennoch hat sich im Völkerrecht basierend auf Jellinek die sog. Drei-Elemente-Lehre durchgesetzt, nach der ein Staat drei Eigenschaften besitzen muss: ständige Bevölkerung, definiertes Staatsgebiet und Regierung (Staatsgewalt). Diese drei objektiven Kriterien sind objektive Kriterien. Es mag sinnvoll sein oder nicht, die Kriterien in Frage zu stellen oder überarbeiten zu wollen, eine soclhe Debatte ist mir aber nicht bekannt. Statt einer solchen Debatte hat sich eine Haltung der Ignoranz der Kriterien und ihrere Ersetzung durch symbolischen Aktionismus durchgesetzt. Die symbolische Anerkennung findet statt, ohne dass die Folgen bedacht werden, vielleicht auch weil die anerkennenden Staaten sie nicht tragen wollen. Übersehen wird, dass dieses Agieren den Weg der Staatenanerkennung aus rein politischer Opportunität eröffnet. Dann kommt es nur noch darauf an, für „meinen Staat“ eine Mehrheit von anderen Staaten für die Anerkennung zu finden. Wenn ein Staat aber anerkannt ist, wie soll bei mindestens einem nicht definierten Staatsgebiet ein darauf beruhender Konflikt gelöst werden? Und wer ist die Staatsgewalt?
Es gibt nun jede Menge Argumentation, dass durch eine symbolische Anerkennung die Voraussetzung für die Bildung eines Staates geschaffen werden sollen, überzeugen tut mich das nicht. Denn entweder Staaten sind ein juristisches Konstrukt oder eben nicht.
Begrenzungs- und Ermöglichungsfunktion von Recht beibehalten
Es ließen sich sicherlich noch weitere Beispiele finden. Mein Plädoyer geht dahin, juristische Begriffe nicht zu politisieren. Eine politische Auffassung zu vertreten und für diese einzutreten ist völlig in Ordnung. Für eine Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen einzutreten schließt das ausdrücklich ein. Dafür gibt es Parlamente, die Gesetze beschließen. Wer also rechtlich etwas ändern will, der schreibt einen Gesetzentwurf und kämpft um Mehrheiten für diesen. Ein Antrag ändert im Übrigen nichts, weil selbst wenn er angenommen werden würde liegt der Ball bei der Regierung (die wird nämlich mit Anträgen aufgefordert etwas zu tun) und kann das dann aussitzen. Die Politisierung juristischer Begriffe, die ihrerseits durchaus auch umstritten sein können, verhindert sowohl die Begrenzungs- als auch die Ermöglichungsfunktion von Recht. Auch Rechtsprechung kann sich ändern, aber solange sie ist wie sie ist, darf sich Politik nicht über sie hinwegsetzen. Politisierung ohne Rechtsetzung, weil es mal eben im politischen Diskurs gerade passt, schadet am Ende Politik und Recht.