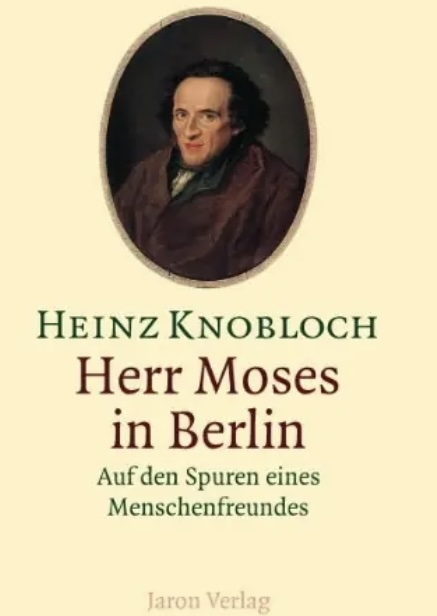Unlängst hat Elif Eralp, die Spitzenkandidatin der LINKEN für das Berliner Abgeordnetenhaus ein Konzept für „Kiezkantinen“ vorgestellt: In jedem Bezirk soll eine öffentlich finanzierte Kiezkantine entstehen, in der „die Leute zu niedrigem Preis eine gesunde und warme Mahlzeit bekommen und auf ihre Nachbarinnen und Nachbarn treffen können … Die günstigste der in den Küchen vor Ort frisch zubereiteten Mahlzeiten soll bereits für drei Euro zu haben sein. Der Aufbau und Betrieb von zunächst 20 Kiezkantinen soll dabei mit 19 Millionen Euro im Jahr gefördert werden. Das würde 0,05 Prozent des aktuellen Haushalts entsprechen.“
So etwas gab es bereits in ähnlicher Form: Die Volksküchen. Zeitweise existierten 15 von ihnen, im 1. Weltkrieg waren es 11 mit 62 Ausgabestellen. 1866 gründete Lina Morgenstern die erste von ihnen und organisierte ihre Tätigkeit im Verein der Berliner Volksküchen. Der Ernährungsrat Berlin nahm erfreulicherweise auf diese Tradition Bezug und das sollte die LINKE auch tun – wäre dies doch zugleich ein Beitrag zum Kampf gegen Antisemitismus: Lina Morgenstern war Jüdin und ihre vielfältige soziale Arbeit, u.a. auch in ihrem Berliner Frauenverein „zur Beförderung der Fröbelschen Kindergärten“ und ihr Engagement für den Frieden im Vorstand der Deutschen Friedensgesellschaft sollte in Berlin im Bewusstsein Linker bleiben, auch wenn sie Teil der bürgerlichen Frauenbewegung war, also nicht in einer proletarisch-revolutionären Tradition stand.
Die Suppenlina – Wiederbelebung einer Menschenfreundin
Sie wäre vermutlich in Vergessenheit verblieben, wenn nicht Heinz Knobloch über sie in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts sein Buch „Die Suppenlina – Wiederbelebung einer Menschenfreundin“ geschrieben hätte. Das war kein Zufall, sondern Folge seines zunehmenden Interesses für die jüdische Geschichte. Besuche in Prag und auf Berliner Friedhöfen haben neben manchem aufschlussreichen Text in Bibliotheken dazu beigetragen. Eine Vielzahl seiner Feuilletons sind Jüdinnen und Juden gewidmet, wie unter anderem in seinem Sammelband „Berliner Grabsteine“ nachzulesen ist. Manches aus der jüdischen Geschichte Berlins und ihren Akteuren bot so viel Überraschendes und Bedenkenswertes, dass er ihnen eigene Bücher widmete.
Der arme Epstein – Wie der Tod zu Horst Wessel kam
„Die Suppenlina“ war das letzte Buch in dieser Reihe. Zuvor erschien 1993 „Der arme Epstein“, das er bereits zu DDR-Zeiten schrieb, aber damals wohl kaum hätte veröffentlichen können, weil der Justizskandal um Sally Epstein, der das Pech hatte, beim Mordanschlag auf Horst Wessel Schmiere zu stehen und dafür von den Nazis nach deren Machtübernahme zum Tode verurteilt wurde, auch seine DDR-Seite hatte: In einem ersten Prozess 1930 hatte Frau Dr. Hilde Benjamin – die langjährige Justizministerin der DDR – die Angeklagten verteidigt und ihr kam es nach Aussage des Prozessbeobachters des sozialdemokratischen Vorwärts mehr auf eine Reinwaschung der kommunistischen Partei als auf einen Schutz der Angeklagten an. Es sei ein Streit unter Zuhältern gewesen, nichts Politisches – das war die Linie der Verteidigung. Sally Epstein war in diesem Prozess aber gar nicht angeklagt, sein Schmierestehen auf der Straße damals nicht bekannt. Er geriet erst 1933 ins Visier der Nazis und da er Jude war, wurde für ihn und einen weiteren Angeklagten ein Mordkomplott gegen Horst Wessel konstruiert. Der hatte in der Gegend Anhänger auch unter früheren KPD-Mitgliedern gewonnen und sollte eine „proletarische Abreibung“ bekommen.
Aber weil er eine Pistole hat, organisieren sich die Rot-Front-Kämpfer auch eine Pistole, Horst Wessel wird angeschossen und stirbt im Krankenhaus an einer Sepsis. 1930 wertet die Justiz das als Totschlag, 1934 als vorsätzlichen gemeinsamen Mord, wofür Sally Epstein zum Tode verurteilt und als erster Jude von den Nazis hingerichtet wurde. Andere kamen in KZs ums Leben.
Seine Pflegemutter setzte durch, dass er auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee beerdigt wird. Eine Elternhinterbliebenenrente wurde zu DDR-Zeiten unter fadenscheinigen Vorwänden lange Zeit abgelehnt und erst 1952 bewilligt. Heinz Knobloch wurde bei seinen Recherchen noch in den letzten Jahren der DDR darauf hingewiesen, dass die Details der von ihm gefundenen Dokumente nicht veröffentlicht werden sollten.
Dieses Buch empfehle ich allen, die über individuellen Terror als Mittel der politischen Auseinandersetzung nachdenken. Zugleich zeigt es, welche Auswirkungen auf die juristische Praxis die Machtübernahme rechter Kräfte damals hatte und auch heutzutage haben wird. Schließlich zeigt es, was Antisemitismus damals bedeutete und heute noch bedeuten kann: Ein Todesurteil.
Der beherzte Reviervorsteher – Ungewöhnliche Zivilcourage am Hackeschen Markt
In der Reichspogromnacht wurde auch Feuer an die große Synagoge in der Oranienburger Straße gelegt. Dann aber geschah etwas, was nicht vorgesehen war: Der Reviervorsteher des Reviers Hackescher Markt erschien mit anderen Polizisten und hinderte die SA an der Fortsetzung ihres Tuns. Er hatte auch die Feuerwehr alarmiert und berief sich bei all dem auf einen Erlass von Kaiser Wilhelm dem Ersten. Der hatte die Synagoge unter Denkmalsschutz gestellt.
Ein Zeitzeuge berichtete, dass dieser Mann auch seinen Vater vor Razzien gegen Juden gewarnt habe – aber er kannte nicht seinen Namen. Das wollte Heinz Knobloch ändern und erzählte die Geschichte in einem Feuilleton im Jahre 1985 in seiner Rubrik „Mit beiden Augen“. Er gab ihm den Titel „Ein Reviervorsteher“ und schrieb: „Da uns sein Name nicht bekannt ist, soll dieser Mann als Bruder Namenlos uns nicht vergessen bleiben“. Er bekam zwei Antworten: Ein Leser meinte, ihn 1945 tot gesehen zu haben, der andere rief ihn an und sagte: „Das war mein Vater“.
Dabei hätte es Heinz Knobloch bewenden lassen können, er aber begann nun erst recht mit dem Recherchieren. Er sprach mit Familienangehörigen, mit den jüdischen Menschen, die diese Zeit noch miterlebt hatten und er erzählte ihre Erinnerungen. Er setzt Otto Weidt ein Denkmal, der in seiner Blindenwerkstatt Juden beschäftigte und sie einmal als „kriegswichtige Arbeitskräfte“ vor der Deportation retten konnte.
Ein wichtiges Thema ist für ihn die Erinnerungskultur der DDR: „Was den der DDR angelasteten ‚verordneten‘ Antifaschismus betrifft, es gab ihn. Aber nach heutigen Vorkommnissen in Deutschland ist mir ein verordneter Antifaschismus immer noch lieber als gar keiner…“ Das steht am Beginn seines Buches „Der beherzte Reviervorsteher“. Dann bricht die – damalige – Gegenwart in seinen Text ein: Anfang 1988 waren Jugendliche in den Jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee eingedrungen und hatten Grabsteine umgeworfen und zerstört. Das wiederholt sich im Februar, also einen Monat später, noch dreimal. Sie wollen die Zahl der umgestürzten Grabsteine überbieten. Nebenan befindet sich ein Volkspolizeirevier, um den Friedhof stehen Mietshäuser: Niemand will etwas gesehen haben. Gefasst wurden sie, als sie mit ihren „Rekorden“ prahlten.
Heinz Knobloch schreibt über sie: „Diese fünf waren geistig und emotional verwildert. Sie waren bindungslos, vom dürftigen Elternhaus abgesehen. Ihre vormaligen Berufswünsche: Einer wollte Unteroffizier werden, ein anderer Polizist. Sie suchten ihren Weg ins Leben in Richtung Abgrund. Und wenn man sie sah und ihnen zuhörte: Vor fünfzig Jahren hätten sie prima SS-Leute abgegeben. Sie sind ein Produkt unserer Gesellschaft.“
Dieses Buch ist 1990 erschienen und zu DDR-Zeiten hätte wohl dieser Satz gestrichen werden müssen. Nach dem Ende dieses Landes konnte Heinz Knobloch aber auch weiter konkret mit Fakten argumentieren:
„Welche Veränderungen hat das landesweite Gedenken an die Pogromnacht, das Ende 1988 durch Staatsakte, Ausstellungen, Gesprächsrunden, Zeitungsseiten und Fernsehsendungen auf vielfältigste Weise angeboten und verstanden wurde, im Lehrplan der Schulen verursacht? Keine.
Im DDR-Lehrplan Geschichte für die Klassen 5 bis 10 für das Schuljahr 1988/89 steht für den Lehrer: ‚… Rassenwahn, massenhafte Judenverfolgung; Entrechtung der sorbischen Bevölkerung. (Information)‘ Das ist alles.
Die ‚Merkzahlen‘, nach denen bei der Prüfung gefragt werden wird, lauten für den Zeitraum bis zum Beginn des zweiten Weltkrieges:
- März 1933 Verhaftung Ernst Thälmanns
- 1935 VII. Kongreß der kommunistischen Internationale‘
Und die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 spielte keine Rolle? Den Tag musste niemand im Herzen bewahren?
- 1935 Brüsseler Konferenz der KPD
- 1936-39 National-revolutionärer Krieg des spanischen Volkes
- 1938 Annexion Österreichs durch Hitlerdeutschland
- 1938 Münchener Abkommen, Zerschlagung der Tschechoslowakei
Und der 9./10. November? Nur als Gedächtnislücke.
- 1939 Berner Konferenz der KPD
Das ist alles. Man fragt nicht nach dem Ereignis, das die zivilisierte Welt empörte.
Merkzahlen, um sich an den Kopf zu fassen …!“
Wer heute Ursachen für die Wahlerfolge der AfD sucht, findet sie auch in diesen Angaben.
Am 9. November 1993 wurde die Landespolizeischule Schleswig-Holstein in einem festlichen Akt umbenannt in „Landespolizeischule Wilhelm Krützfeld“. Er stammte von dort: Aus Berlin, einem Ortsteil der Gemeinde Seedorf.
Meine liebste Mathilde
Geschichte – zum Berühren
„Meine liebste Mathilde“: Dieses Buch verdanken wir einer Zeitungsmeldung und einem Schreibfehler. Die Zeitungsmeldung erschien 1980 im Osten Berlins und lautete: „Westberlin. ADN. Die Behörden des Westberliner Bezirks Wilmersdorf haben den von Eltern, Lehrern und Schülern gemeinsam eingebrachten Antrag abgelehnt, ihrer Schule den Namen ‚Rosa Luxemburg‘ zu geben.“ Welche Schule war das? Heinz Knobloch wollte es genau wissen. In der Wilmersorfer Cäcilienschule gab es in ihrer Todesnacht einen Zwischenaufenthalt. Recherchen ergaben, dass die in der Zeitung nicht namentlich genannte Schule früher nicht so hieß. Aber welche war es dann?
Heinz Knobloch kam bei seiner Suche an einen Stadtplan „Hundert Jahre revolutionäres Berlin“, in Westberlin erschienen. Im Begleitheft findet er unter Nummer 168 „Berlin Moabit, Altonaer Straße 11, Gartenhaus, 2. Stock. Hier wohnt und arbeitet bis 1942 Mathilde Möhring, die Sekretärin Rosa Luxemburgs und ihre Vertraute.“ Es folgt ein Zitat: „Aber kein Personenregister der deutschen Arbeiterbewegung nennt eine Mathilde Möhring. Aber eine Mathilde Jacob. Sie steht unter dieser Adresse auch noch im letzten Vorkriegsadressbuch von 1939.“
Heinz Knobloch fragte beim Autor des revolutionären Stadtplanes nach, vermutete in ihm einen Fontaneverehrer, denn von dem stammt der Roman „Mathilde Möhring“ und der antwortete prompt: „Die Quelle dieses Fehlers muss in meinem Unterbewusstsein liegen, weiß der Himmel oder Freud. … Natürlich heißt sie Jacob und nicht Möhring.
Seltsam. Sekretärin und Vertraute von Rosa Luxemburg? Nie gehört. Dann werden wir diese Frau suchen. Sie interessiert mich.“
Und wieder ließ Heinz Knobloch Leserinnen und Leser an seiner Suche teilhaben. Ende 1913 sind sich Rosa Luxemburg und Mathilde Jacob in ihrem Schreib- und Übersetzungsbüro begegnet, seitdem schrieb sie ihre Artikel ab und als Rosa Luxemburg 1915 verhaftet wurde, hielt sie den Kontakt zu ihr, zunächst im Gefängnis Barnimstraße in Berlin und später in der Festung Wronke in der preußischen Provinz Posen. Sie versorgte sie mit Lebensmitteln und Nachrichten und überbrachte Mitteilungen an ihre Kampfgefährten. 1915 schmuggelte sie Rosa Luxemburgs Manuskript „Die Krise der Sozialdemokratie“ aus dem Gefängnis. Und sie wurde zu einer Freundin.
Bis zum Erscheinen des Buches von Heinz Knobloch war ihr Name in der DDR bestenfalls ein paar Experten bekannt. Das ist erklärbar: Mit dem kurzzeitigen Vorsitzenden der KPD Paul Levi eng verbunden, teilte sie seine politischen Ansichten und verließ mit ihm 1921 diese Partei. Über die USPD trat er später wieder in die SPD ein. Seit 1921 war sie Redakteurin seiner Zeitschrift „Unser Weg“. All das war in der DDR kein Grund für Forschungsarbeiten oder eine Erwähnung in Büchern und Zeitschriften.
Mathilde Jacob hatte viele Dokumente und Briefe von Rosa Luxemburg gesammelt. Über Freunde gelangte die Nachricht davon in die USA. Der Direktor der Hoover-Stiftung Ralf H. Lutz fuhr nach Berlin und konnte unter konspirativen Bedingungen diese Dokumente in die USA bringen. So blieben sie für die Forschung erhalten. Sie selbst wurde als Jüdin schikaniert und schließlich nach Theresienstadt deportiert, wo sie umkam. Einen Verwandten rettete sie, indem sie ihn in einem Fragebogen für tot erklärte.
Manches ist so auch für dieses Buch erhalten. Die Suche in Archiven brachte Heinz Knobloch aber auch eine Fülle von authentischem Material aus der Hand von Mathilde Jakob, erschütternde Einzelheiten der Verfolgung der Berliner Juden und handgeschriebene Mitteilungen.
Überall in der Welt – sogar in Australien – suchte und fand er Menschen, die Mathilde Jacob kannten, zuletzt ihren Neffen – in Westberlin… Ganz am Ende des Buches beschreibt er, wie dieser Mann mit ihm zu seiner Wohnung fährt: „Gegenüber ist ein Parkplatz. Er biegt links ein, hält und ich will schon aussteigen.
Stopp mal, sagt er und startet wieder. Hinter uns hat er eine andere Parklücke entdeckt. In die fährt er nun rückwärts hinein. Dabei sagt Mathilde Jacobs Neffe lächelnd, aber nicht verlegen: ‚Der Fluchtweg muss immer offen sein…‘“
Herr Moses in Berlin – Auf den Spuren eines Menschenfreundes
Mit seiner Großmutter ging Heinz Knobloch gern zum Tolkewitzer Johannisfriedhof. Dort hat er neben dem Grab seines Großvaters mit Hölzchen, Moos und roten Käfern gespielt. „So kam es, dass ich nie Bange hatte und später gern solche Stätten aufsuchte, bald merkte, man geht dort ungestört seinen Gedanken nach, wird nicht überfahren und kaum abgelenkt. Der Friedhof gibt Frieden und innere Ruhe – falls dort niemand liegt, der dir nahestand.“
Manche dieser Grabsteine mögen ihm beim Spazierengehen aufgefallen sein, manche Grabstätten berühmter Persönlichkeiten hat er dem Werk von Willi Wohlberedt zu verdanken, der von den zwanziger Jahren bis zum Ende der vierziger Jahre in vier Bänden die Gräber berühmter Berliner Persönlichkeiten verzeichnete. Sie waren immer wieder der Anlass für Feuilletons über ihr Leben.
Und eines dieser Gräber war nicht zu erkennen, wenigstens nicht auf den ersten Blick:
„Misstraut den Grünanlagen. Beginnt es mit einem zufälligen Blick beim Spazierengehen im zerbröckelnden alten Berlin? Eine Häuserlücke, davon gibt es viele, als Rasenfläche getarnt, auch das haben wir mehrfach, und zugleich offenbart sie sich durch einen Denkstein, das ist selten. Seine betrübende Inschrift wird noch mitgeteilt.“
So beginnt das Buch: „Herr Moses in Berlin“. Was für ein Wagnis: Heinz Knobloch schreibt ein Buch über einen Menschen, den kaum einer kennt. Seinen Enkel Felix Mendelssohn Bartholdy, ja, von dem gibt’s immer mal wieder Musik im Konzertsaal, im Radio oder auf Tonträgern – aber wer war Moses? Vielleicht ist ja aus dem Deutschunterricht – bei manchem so wie bei mir – noch hängengeblieben, dass er das Vorbild für Lessings „Nathan der Weise“ gewesen war. Aber mehr wusste ich nicht über ihn. Und nun kommt das Erstaunliche: Heinz Knobloch ging es genauso.
„Eigentlich wollte ich über Moses Mendelssohn nur eine Zeitungsseite schreiben. Ich kannte zuerst kaum seinen Namen und begann Material zu sammeln, spürte ihm nach, las mit immer mehr Erstaunen, wer er war.“
Und so schrieb Heinz Knobloch auf 475 Seiten eine Biografie – nein, diesen Anspruch weist er von sich: „Ein besseres Buch über Herrn Moses wäre möglich, wenn er aktiv im Bewusstsein unserer Gegenwart vorhanden lebte. Er tut es nicht. Folglich wäre seine Biographie vonnöten. Die kann ich nicht schreiben. Die dürfte verfassen, wer für jenes Jahrhundert und für all das philosophische Hin und Her vor dem Marxismus ein zulänglicher Fachmann gewesen ist.“
Dieses Buch ist in all seinen Teilen immer auch ein Dokument der Annäherung des Autors an seinen Gegenstand. Daher sind die Beschreibungen von Mendelssohns Leben, seiner Werke und der Zeitgenossen, die zu ihm in einer Beziehung standen, immer mit den Recherchen Knoblochs und mit vielerlei Bezügen zur Gegenwart der 70er Jahre verbunden.
Da sind einige originelle Spitzen über die plötzliche Preußenverehrung der DDR-Führung Ende der 70er und zu Beginn der 80er Jahre auffindbar.
Da zeichnet der Amateurhistoriker Knobloch ein beeindruckendes Lebensbild dieses Mannes, was ihm möglich wird, weil er eine Vielzahl von Quellen auswertet, sie übersichtlich einordnet und nicht vergisst, manche Schilderungen von Zeitgenossen so einzufügen, dass sie Zeit und Lebensumstände dieses außerordentlichen Menschen bildhaft-anschaulich wiedergeben.
Wer „Herr Moses in Berlin“ heute liest, bekommt einen umfassenden Überblick über die Kämpfe eines wichtigen Teils der jüdischen Bevölkerung Deutschlands im 18. Jahrhundert um ihre Emanzipation. Es enthält erschütternde Beispiele für Willkür und Antisemitismus und zugleich für Respekt und mutiges Eintreten deutscher Künstler und Schriftsteller für die Gleichberechtigung der Juden: Als der Schauspieler Johann Brockmann erfahren hatte, dass Moses Mendelssohn in einer Vorstellung des „Hamlet“ im Publikum sein würde, sprach er an diesem Abend den berühmten Monolog in dessen deutscher Übersetzung.
Am 3. März 1926 wäre Heinz Knobloch 100 Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum ist ein Grund, sein Interesse, seinen Respekt und seinen Einsatz für jüdisches Leben in Berlin uns allen wieder ins Gedächtnis zu rufen. Heute, wo Antisemitismus wieder vielfältige Verbreitung findet und sich gar hinter linken Phrasen tarnt, sind dem Werk von Heinz Knobloch viele neue Leser zu wünschen.
PS Wenn sich nun die LINKE für Kiezkantinen engagiert, sollte sie sich dabei – wie bereits der Ernährungsrat Berlin – auf die jüdische Begründerin der Volksküchen Lina Morgenstern berufen und vielleicht dieser künftigen Institution oder wenigstens einer dieser Einrichtungen ihren Namen geben. Vielleicht der in Neukölln?